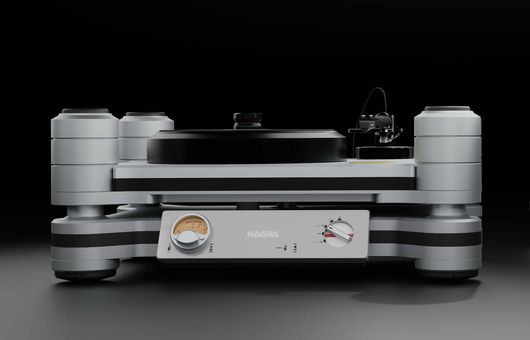Die in der Nähe von Augsburg angesiedelte Manufaktur Blumenhofer Accoustics entstand aus der Passion des heute 57-jährigen Thomas Blumenhofer. Schon in jungen Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für Lautsprecher. Als Nebenerwerb und Hobby entwickelte er zu Beginn leistungsstarke Hornlautsprecher für Diskotheken in der Umgebung. Schon bald genoss man auch in einigen bayrischen Bierhäusern in beseelter Atmosphäre die Beschallung mit Blumenhofer-Produkten.
Seit 1976 produziert er auch Hornlautsprecher fürs Wohnzimmer, wobei "Livehaftigkeit" auch im Hausgebrauch immer sein Anspruch blieb. "Livehaftigkeit" kommt von ungebremster Dynamik und kohärentem Impulsverhalten – genau das sind zwei Stärken von Hornlautsprechern. Nach einer Periode von ungefähr 15 Jahren, in denen er mit allen möglichen Arten von Musikwiedergabesystemen wie Bändchen und Elektrostaten experimentierte, kehrte Thomas Blumenhofer zurück zu seiner ursprünglichen Liebe: dem Hornlautsprecher.
Im 2004 kam die Genuin FS 1 auf den Markt und begründete eine neue Ära. Wenige Jahre später, 2009, schuf man mit Blumenhofer Accoustics das heute bestehende Firmengebilde, arbeitete mit Erfolg an der Modellplatte und exportiert heute die bayrischen Hornlautsprecher weltweit. Ein weiteres Geschäftsfeld sind kundenspezifische Installationen. Da wird ein grosser Hornlautsprecher schon auch mal fürs eigene Haus massgeschneidert hergestellt.


 Alle Themen
Alle Themen